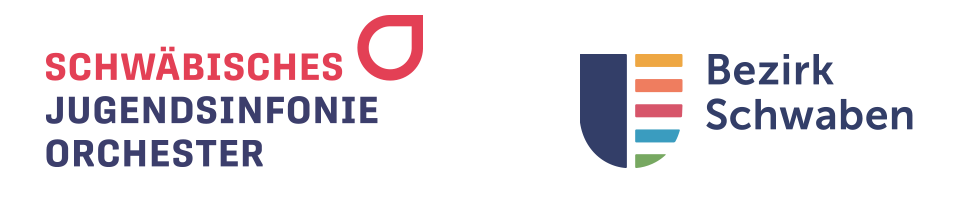Patrick Schäfer: »Dust« - Konzert für Orchester
In Schwaben und international ist er längst bekannt: der Komponist Patrick Schäfer. Geboren 1993 in Augsburg, studierte er in München, Stuttgart, Graz und Köln. Zum 500. Jubiläum der Reformation schrieb er die Oper »Letzte Nacht«, die 2017 in Augsburg mit den Augsburger Philharmonikern unter der Leitung von Carolin Nordmeyer uraufgeführt wurde. Danach begann der »Preis-Regen«: 2018 erhielt er den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg, 2022 gewann er den Mauricio Kagel Kompositionswettbewerb in Wien, 2023 folgten der Kompositionspreis des Deutschlandfunks im Rahmen des Deutschen Musikwettbewerbs sowie der Musikförderpreis des Bezirks Schwaben. 2022 hatte der Förderverein des Schwäbischen Jugendsinfonieorchesters ein neues Werk bei ihm in Auftrag gegeben. Ein Werk, das das Jahresmotto 2024 des Bezirks Schwaben »Nachhaltig. Zukunft. Sichern« auf eine sehr eigene Weise betrachtet. Der Kulturmanager des Bezirks Matthias Hain hat mit ihm über sein Stück gesprochen.
Lieber Patrick, dein Stück trägt den Titel »Dust« und setzt sich auseinander mit den Fragen, ob Materie klanglich dargestellt und somit in Musik ausgedrückt werden kann, was die Menschen von heute zukünftigen Generationen hinterlassen – also »Staub, Schmutz«. Wie man einen Fluss in Musik setzt, wissen wir spätestens seit Bedřich Smetanas »Moldau«. Mit Richard Strauss’ »Alpensinfonie« hat unser sjso sein Publikum im vergangenen September durch Gewitter und Sturm geschickt. Aber wie komponiert man denn Staub?
Instrumentalstücke, die ganz konkrete Phänomene benennen, egal, ob nun einen Fluss oder ein Naturereignis, sind in besonderer Weise mit der Herausforderung konfrontiert, dass Musik sehr abstrakt ist. Im Vergleich zur Malerei, Literatur oder zum Film ist in Musik weder etwas abgebildet, noch benannt. Musik öffnet aber Assoziationsräume. Sie kann unsere Fantasie und Gefühlswelt anregen – in manchen Fällen spüren wir sie sogar ganz unmittelbar körperlich. Für mich ist Musik also nicht gänzlich abstrakt. Die Klänge sind da – aber das, wofür sie stehen, bleibt in den allermeisten Fällen eine Behauptung.
Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – gibt es eine Vielzahl an Stücken, die mit unterschiedlichen Mitteln versuchen, sich dem Konkreten anzunähern: Durch Lautmalerei etwa oder dem Beifügen einer Geschichte, eines bestimmten Programms, das im jeweiligen Stück im weitesten Sinne vertont werden soll.
Ich habe mich unter anderem deshalb für Staub entschieden, weil er wie Musik abstrakt und konkret zugleich ist. Bestimmte Arten von Staub gehören zu den kleinsten Entitäten, die wir noch mit dem Auge wahrnehmen können. Damit gehen einige Eigenschaften einher – beispielsweise die Tatsache, dass er keine ihm eigene Klanglichkeit besitzt. Wir können sie höchstens imaginieren. Sich eine solche auszudenken und als Komponist immer wieder im Stück anzubieten, empfand ich als schönes Projekt.
Dennoch war es weniger die Suche oder Behauptung einer Klanglichkeit von Staub, sondern »Staub als Prinzip«, woran ich mich am meisten abgearbeitet habe: Die geringe Aktivierungsenergie, die es braucht, um ihn aufzuwirbeln oder wie er sich mehr und mehr auf ungenutzte Gegenstände legt und damit Protokoll unserer Abwesenheit wird, erschienen mir beispielsweise gut als Analogie in Musik überführbar. Auch im Stück gibt es Klänge, die zunächst verdeckt sind. Mal werden diese mit kleinsten Gesten freigesetzt, mal muss man eine ganze Menge Staub aufwirbeln, um sie zum Leuchten zu bringen. Beispielsweise gibt es eine Stelle, an der ich die Streicher einen Akkord spielen lasse, der keine leeren Saiten enthält. Durch den Fingeraufsatz auf die Saiten wird nicht nur die Tonhöhe bestimmt, sondern auch der ursprünglich reine Klang der Saite »verunreinigt«. Dieser Akkord mündet dann in einen weiteren, der auf sämtlichen leeren Saiten gespielt wird. Ein »verschmutzter« Klang wird gewissermaßen vom Staub befreit und in einen »sauberen« aufgelöst.
Wie muss man sich im vorliegenden Fall deinen Kompositionsprozess vorstellen? Du bist ja von einer konkreten Idee ausgegangen. Wie systematisch kann man da vorgehen und welche Rolle spielt dann noch die Inspiration?
Tatsächlich ist die Frage nach formaler Systematik und gleichzeitig inspiriertem Moment eine der Herausforderungen, die ich mit am komplexesten beim Komponieren empfinde. Es ist für mich ein Ideal und eine Herausforderung, Musik zu schreiben, deren einzelne Momente inspiriert sind, ohne dass sie in diese zerfällt, sondern vielmehr in der Ausdehnung der Zeit über diese einzelnen Momente hinauswächst. Daraus resultiert die Notwendigkeit, dass sich die Momente eines Stücks in ihrer Großform bewähren müssen – und die Großform in ihren Momenten. Für mich entsteht dabei die Notwendigkeit, viel und lange mit Skizzen zu arbeiten, mich einem Material immer weiter anzunähern und mit diesen nochmals zu jonglieren, wenn ich zu konkreten Momenten oder auch Formabschnitten gekommen bin. Aber zu dieser Arbeit gehört auch, Ideen und Formabschnitte wieder zu löschen, die eben nicht funktionieren. Im Falle von »Dust« war das besonders herausfordernd und langwierig, weil das Stück sehr dicht ist. Allein ein paar Sekunden Musik für das Orchester gedanklich zu organisieren und auf Papier zu schreiben, beansprucht viel Zeit.
Du interessierst dich sehr für Bildende Kunst. Welche Eindrücke oder Erlebnisse sind von dieser Seite in dein neues Werk eingeflossen?
Die Idee, ein Stück über Staub zu schreiben, trage ich schon seit 2016 mit mir herum. In dieser Zeit bin ich immer wieder auf Arbeiten von Kunstschaffenden gestoßen, die mich bis heute noch faszinieren. Beispielsweise die Konzentration und feine Sinnlichkeit von Nadja Küchenmeisters Gedicht »Staub« oder die Vielfalt von Hausstaub, die sich offenbart, wenn man den Hausstaub unterschiedlicher Wohnungen und Geschäfte zusammenkehrt, wie es der Fotograf Klaus Pichler in seinem Bildband »Dust« getan hat.
Damit sind wir bereits mitten in deinem Stück: Welche kompositorischen Besonderheiten weist »Dust« auf, insbesondere im Vergleich zu deinen anderen Werken?
Die letzten Jahre habe ich mich in Kammermusik- und Solo-Stücken sehr mit Klangerzeugung, dem Verhältnis zwischen dem Spieler und seinem Instrument und den damit auch darstellerisch entstehenden Implikationen beschäftigt. Zuletzt bin ich über die Verwendung von klanglichen Symbolen, Text und einer imaginären Bühnensituation zu einer sehr theatral gedachten Vorstellung von Musik gekommen. Dies alles sind Aspekte, die vom Orchester durch die schiere Menge der Ausführenden zunächst verkompliziert werden. Trotzdem wollte ich versuchen, auf das Orchester zu übertragen, was ich an meiner Auseinandersetzung mit Solobesetzungen gefunden habe: das Orchester zu einem Instrument und einem Spieler werden zu lassen, das sich als eine Masse von zunächst kleinen Geräuschen auf etwas legt, sich aufwirbeln lässt und schwer atmen muss unter all dem aufgewirbelten Material.
Die zeitgenössische Musik zeichnet sich ja u.a. dadurch aus, dass die Musikerinnen und Musiker ihre Instrumente auf ungewöhnliche Weise »traktieren« müssen. Welche besonderen Spielarten schreibst du in deinem Stück vor und welche Effekte möchtest du dadurch erreichen?
Erweiterte Spieltechniken erhöhen die klangliche Vielfalt und geben mir die Möglichkeit, kompositorische Ideen musikalisch vielseitiger und kontrastreicher auszuformulieren. In »Dust« gibt es eine Vielfalt von zunächst kleinsten Geräuschen, die als Grundrauschen das ganze Stück durchziehen. Mit der Zeit bilden sich in diesem Grundrauschen eigene Figuren, die nach und nach zu immer größeren Klanggebilden anwachsen. Zu diesem Grundrauschen gehören beispielsweise die winzigen Klappengeräusche der Holzbläser und das Tippen der Holzseite der Streicherbögen auf den Saiten der Streicher am Anfang des Stücks oder die sehr dichten Akkorde und Polyrhythmen in der Mitte. Die Möglichkeiten von erweiterten Spieltechniken sind ebenso unbegrenzt wie die Möglichkeiten von Tonhöhen. Ein anderer Ansatz, den ich im Stück anwende, ist das bloße Ausstellen eines einfachen Einatmens durch das ganze Orchester. Symbolartig steht es vor jedem neuen Formabschnitt des Stücks, bis es irgendwann, ergänzt um das kollektive Ausatmen des Orchesters, eine existenzielle Schwere bekommt: Mit ihm wird nun das gesamte musikalische Material synchronisiert und kommt im letzten Atemzug zum Erliegen. Staub zu Staub – auch daran musste ich beim Komponieren immer wieder denken. Ich hatte das Ziel, das Stück ab einem bestimmten Punkt in ein (ökologisches) Requiem zu überführen. Der Atem, verteilt über das ganze Stück, fungiert dabei gleichermaßen als Symbol und Scharnier, um irgendwann das restliche musikalische Material dahin umzudeuten.
Steht das Klangereignis im Vordergrund oder gibt es noch so etwas wie einen »thematisch-motivischen« Entwicklungsprozess, eine Dramaturgie?
Für mich steht das Klangereignis nicht im Vordergrund. Geräusche und Tonhöhen sind zusammen gedacht, sie sind Teil einer gemeinsamen Farbpalette, die unterschiedliche formale Strategien durchläuft. Diese Strategien sind nicht im klassisch-romantischen Sinne thematische Entwicklungen. Sie sind aber sehr wohl dramaturgisch gedacht, beispielsweise durch die Progressionslogik von kleinsten Geräuschen zu großen Klanggebilden beim beschriebenen Grundrauschen oder dem Foreshadowing des Requiem-Abschnitts durch das Einatmen.
Während des Kompositionsprozesses hast du erzählt, wie sehr du bis zuletzt mit der richtigen Form, den richtigen Proportionen gerungen hast. Nun ist die Musik des 20. Jahrhunderts und die zeitgenössische Musik bekannt dafür, Formen eigentlich sprengen zu wollen. Kann man heutzutage noch mit »klassischen Formen« komponieren und falls ja, welche davon finden sich in »Dust«?
Was den Gedanken, »Formen sprengen zu wollen«, für mich heute am ehesten relevant macht, ist die Notwendigkeit, eine eigene Position zu bestimmten Phänomenen und eine entsprechende Herangehensweise zu entwickeln. Das schließt die Verwendung klassischer Formen nicht grundsätzlich aus. Meine eigene Suche nach der richtigen Form bestand aber nicht in der Frage, ob ich meinem Material eine Sonatenhauptsatzform oder einen anderen bekannten Formtyp gebe, sondern im Entwickeln eigener formaler Prinzipien, die meinem Material gerecht werden und gleichzeitig mich dessen Entwicklungen vollziehen lassen, die ich mir dafür vorgestellt habe.
Gab es in deiner Kindheit ein Ereignis, das dich den Entschluss fassen ließ, Musik zu studieren? Wann wusstest du, dass du Komponist werden wolltest?
Ich wollte die meiste Zeit meiner Kindheit Komponist werden. In den Freundschaftsbüchern, die man in der Grundschule mit Lieblingsfarbe, Lieblingstier und ähnlichem ausfüllt, habe ich schon damals bei Traumberuf »Komponist« geschrieben. An ein bestimmtes »Erweckungserlebnis« kann ich mich nicht erinnern, aber die klassische Musik, die meine Eltern hörten, hat mich sehr begeistert. Ich nehme an, dass sich deswegen in mir der Wunsch entwickelt hat, so etwas auch zu tun.
Hast du kompositorische Vorbilder, z.B. deine Lehrer oder eventuell sogar Komponisten der Vergangenheit?
Natürlich gibt es immer wieder Komponisten und Komponistinnen, die durch ihre Arbeit, einzelne Stücke, ihre Persönlichkeit oder auch bestimmte Arbeitsmethoden zeitweise oder dauerhaft Vorbilder für mich sind. Und natürlich gibt es Unmengen an Musik, die mich sehr begeistern. Eine konkrete Figur könnte ich aber nicht benennen.
Wenn der letzte Ton deines neuen Stückes verklungen sein wird, welche Reaktion des Publikums würdest du dir wünschen, auf welche Weise möchtest du die Zuhörer bewegen?
Der größte Wunsch, den ein Publikum einem erfüllen kann, ist offenes und unvoreingenommenes Hören. Welche sinnlichen Eindrücke, Bilder oder Gefühle bei jedem und jeder einzelnen dann entstehen, ist auch für mich als Komponisten des Stücks ein Geheimnis, das herauszufinden mich immer wieder motiviert, das nächste Stück zu schreiben.
Interview: Matthias Hain